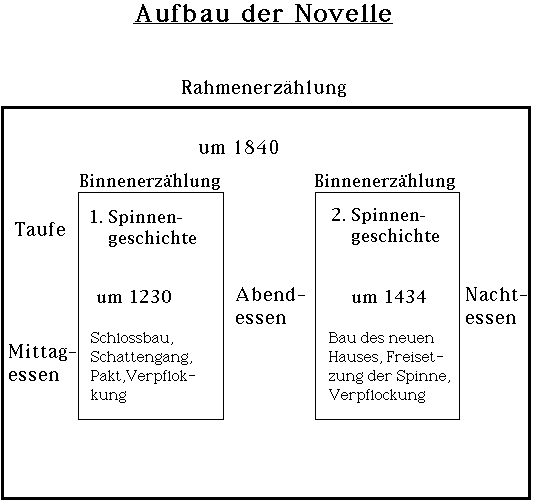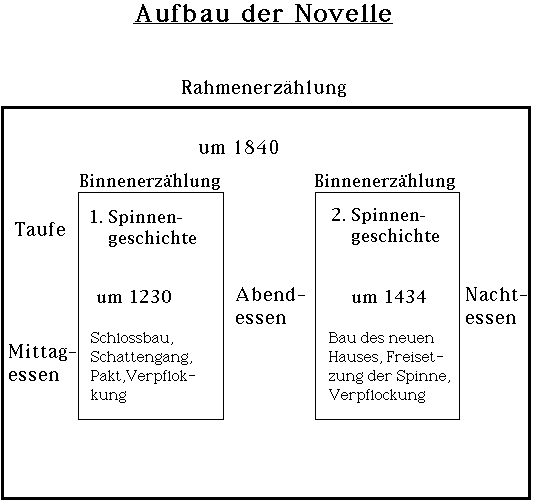
1) Einleitung
Autor
Jeremias Gotthelf ist nur der Künstlername des Autors; in Wirklichkeit
hiess er Albert Bitzius. Er nahm den Namen der Titelgestalt seines ersten
Romans "Der Bauern Spiegel" an. Er wurde 1797 in Murten geboren, studierte
Theologie und wurde dann Pfarrer. Erst mit 39 Jahren begann er zu schreiben.
Er schrieb zahlreiche andere Werke, die ich nicht nennen werde; Die Schwarze
Spinne war das Buch, mit dem er in die Weltliteratur aufstieg. Es wurde
1842 geschrieben. Es ist zu bemerken, dass alle seine Werke in der Schweiz
spielen.
2) Zusammenfassung
An einem schönen Tag im Berneroberland bereitet sich eine Bauernfamilie auf die Taufe ihres Knaben vor. Alle Mägde und Knechte arbeiten fleissig, ausser der Gotte sind alle Gäste anwesend. Als diese nun schweissbedeckt ankommt, will sie zuerst nichts essen, gibt aber schliesslich nach und verzehrt alles. Auf dem Weg zur Kirche bemerkt die Gotte, dass sie den Namen des Knaben nicht weiss. Sie darf allerdings nicht danach fragen, da dies Unglück über das Kind bringt. Alles wendet sich zum Guten, als der Pfarrer den Namen während der Taufe erwähnt. Nach dem Mittagessen begibt sich die Familie in den Garten und beginnt źber das Haus zu reden, da dies neu ist. Da erinnert sich der Grossvater an die folgende Geschiche:
Etwas weiter vorne befand sich 600 Jahre zuvor ein Schloss, das von
Rittern des Teutschen Ordens bewohnt wurde. Der Komtur von Stoffeln, das
ist der oberste Ritter, befahl, dass die Bauern auf dem eineinhalb Stunden
entfernten Bärhegenhubel ein Schloss bauen sollten. Er sorgte dafür,
dass die Frist eingehalten wurde. Die anderen Ritter erschwerten den Bauern
die Arbeit. Nach zwei Jahren war die Burg fertig; nun wollten sich die
Bauern wieder ihren vernachlässigten Feldernwidmen, doch von Stoffeln
wollte, dass sie ihm einen Schattengang aus Buchen aus dem drei Stunden
entfernten Münneberg errichten und zwar binnen 30 Tagen. Auf dem Rückweg
trafen sie den Teufel, der ihnen vorschlug, die Buchen vom Kirchstalden
bis zum Bärhegenhubel zu transportieren. Als Gegenleistung verlangte
er ein ungetauftes Kind. Im Dorf belauschte Christine die Diskussion der
Männer, die über die Situation berieten. Sie schloss dann drei
Tage später einen Pakt mit dem Teufel. Als Pfand gab er ihr einen
Kuss auf die Wange, da keine Frau ein Kind erwartete. Christine berichtet
den Männern von diesem Ereignis, erwähnte aber den Kuss nicht.
Nun transportierten diese jeden Tag die Buchen bis zum Kirchstalden. Von
Stoffeln war es gleichgültig, ob die Bauern ihre Seelen verpfändet
hatten, solange sie ihre Abgaben bezahlten. Frauen und Ritter, die versuchten
den Teufel nachts zu beobachten, wurden tot oder verletzt gefunden. Nur
ein kleiner Junge konnte dasSchauspiel sehen, als er den Priester zu einem
Sterbenden holte. Termingerecht wurde der Schattengang fertig. Bauern feierten,
Ritter und Teufel verspottet zu haben. Nur aus Eitelkeit liess von Stoffeln
die Allee nicht wieder abreissen.
Nach der ersten Geburt begann auf Christines Wange ein schwarzer Fleck
zu wachsen, da das Kind sofort nach seiner Geburt getauft wurde. Bei der
zweiten Geburt und Taufe wuchs aus Christines schwarzem Fleck unter unmenschlichen
Schmerzen eine Kreuzspinne, die sofort unzŠhlige kleine Spinnen gebar,
die alles Vieh tšteten. Von Stoffeln erfuhr vom Pakt und bedrängte
die Bauern, ihn einzuhalten. Während der Uebergabe des dritten Kindes
schaffte es der Pfarrer, das Kind zu taufen. Daraufhin verwandelte sich
Christine in eine schwarze, ekelerregende Spinne. Der Pfarrer schleuderte
sie weg. Ein paar Tage danach starb er an einer Krankheit mit schwarzen
Beulen. In der Folgezeit tauchte die Spinne unberechenbar auf und vergiftete
die Menschen. Auch die Ritter wurden nicht verschont.
Alle Fluchtversuche und Unternehmungen der Bauern schlugen fehl. Eine
junge Frau überlegte, ob man sie nicht einsperren kšnne. Als diese
über das Bett der Kinder lief, packte sie die Frau, steckte sie in
ein Loch im Fensterposten, das sie vorbereitet hatte, und verschloss das
Loch. Danach starb sie.
Als der Grossvater seine Erzählung beendet hat, fühlt jeder die Spinne über seinen Rücken laufen. Beim Abendessen ist die Atmosphäre nicht gerade die beste. Danach wollen alle wissen, was mit der Spinne geschehen ist. Also erzählt der Grossvater die Geschichte weiter:
Während 200 Jahren lebten die Bauern fromm, und die neuen Ritter waren milde. Dann zogen einige nicht-einheimische Frauen ins Tal und brachten Hochmut und Eitelkeit. Sie waren überhaupt nicht fromm. Im Haus mit der Spinne wohnte eine solche Frau, die einen gottesfürchtigen Sohn namens Christen hatte. Da ihr das Haus nicht gefiel, liess sie ein neues bauen. Wegen eines komischen Surrens flohen alle Gäste während der Einweihungsfeier aus dem Haus. Im Haus wohnten jetzt die Bediensteten ohne Aufsicht, obwohl Christen dagegen war. Um die Mägde gefügig zu machen, warfen die Knechte Gegenstände auf den Fensterposten. Ein unberechenbarer Macho-Knecht drohte das Loch zu öffnen. Am Heiligen Abend, als niemand es glaubte, dass er es tun würde, öffnete er das Loch, die Spinne kam heraus und tötete alle Anwesenden. Diesmal war sie noch viel grausamer als das letzte Mal. Alle gaben Christen die Schuld und lebten fromm weiter, als ob sie es immer gewesen wären. Christen bereitete die Verpflockung der Spinne vor. Als eine Frau ein Kind gebar, nahm er es und brachte es zu Pfarrer. Auf dem Weg sah er die Spinne. Er gab das Kind einem kleinen Jungen. Christen packte die Spinne, brachte sie unter unmenschlichen Schmerzen zum Haus und verpflockte sie. Daraufhin starb er. Das neue Haus brannte ab.
Alle fragen den Grossvater, wie er das neue Haus gebaut habe, ohne dass die Spinne herausgekommen sei. Er sagt, dass er beim Bau des Hauses den alten Fensterposten erwendet habe.
3) Textbeispiele
S. 54, ersten Abschnitt
S. 114-115, Christen bringt Spinne
4) Aufbau
Die Geschichte besteht aus einer Rahmenerzählung und zwei Binnenerzählungen, die miteinander in Beziehung stehen, die zweite ist die Fortsetzung der erste.
Thema
Die Spinne repräsentiert die Pest, die die sündigen Menschen bestraft. Vieles dreht sich um den Teufel oder Gott. Es beschreibt die Lage der Bauern im 13. Jh unter dem Feudalismus, wenn sie einen bösen Herrn hatten.
Personen
Grossvater: Er geht langsam und gebeugt mit einem Stock. Er ist
alt und strahlt Würde aus. Seine Aufgabe ist es aufzupassen, dass
traditionelle Verhaltensweisen weitergehalten und weitergeben werden, aus
diesem Grund erzählt er die Spinnengeschichten.
Gotte: Sie ist kräftig, nimmt Rücksicht auf andere
, kann sich zur Wehr setzen und ihre Meinung vertreten. Jedoch neigt sie
auch zur falschen Bescheidenheit und ist abergläubisch. Auf religišser
Ebene läuft sie Gefahr, vom rechten Weg abzukommen
Christine: Sie kommt aus Lindau am Bodensee, mischt sich gerne unter die Männer. Sie beschimpft diese auch der Faulheit, als sie die Bäume nicht hochtragen kšnnen. Darum schliesst sie einen Pakt mit dem Teufel. Sie versucht die Bauern dazu zu überreden, diesen einzuhalten. Als sie in Berührung mit Weihwasser kommt verwandelt sie sich in eine Spinne.
Christen: Er ist gottesfürchtig und fromm. Als im Haus der
Bediensteten die Spinne ausbricht, geben die Bauern ihm die Schuld. Er
nimmt sie auch auf sich und bereitet die Verpflockung der Spinne vor. Als
er sich geopfert hat, bemerken die Bauern, was er vollbracht hat.
5) Interpretation
Motive/Symbole
Kinder: Es fällt auf , dass Kinder, wenn sie näher
beschrieben werden, in Form von kleinen Jungen auftreten. So wird schon
in der Rahmenerzählung ein Junge getauft. In den Kindern liegt für
Gotthelf die Hoffnung auf Verbesserung der Zustände. Die Erwachsenen
haben die Aufgabe, ihnen auf den rechten Weg zu helfen: In dem sinne kritisiert
der Grossvater einen kleinen Buben für sein nachlässiges Verhalten
beim Ausmisten des Kuhstalles
Die Jungen bewältigen sinnvolle Aufgaben , die man ihnen nicht
zu trauen würde: In der ersten Binnengeschichte schickt eine junge
Frau bei einsetzenden Wehen ihren Sohn, um Hilfe zu holen, auf das Feld.
Kinder werden vom Bösen verschont: Als einziger beobachtet ein
kleiner Junge unverletzt den Teufel beim Bau des Schattenganges.
Erwachsene opfern sich für ihre Kinder : Christen zieht mit seinen
Kindern in das alte Haus und bereitet sich auf die Einpflockung der Spinne
vor.
Haus: Seit über 600 Jahren baut ein Berner Bauerngeschlecht
sein Haus an derselben Stelle und die jeweils darin lebenden Generationen
folgen mehr oder weniger seinen sittlich-religiösenen Verhaltensweisen.
Diese werden in Form einer Familiensage überliefert, die die jeweils
jüngere Generation lehrt,was ein Haus bauet und ein Haus zerstört,
was Segen bringt und was Segen vertreibt. Der Anlass und der Prozess des
Hausbaus sowie die Lage des Hauses entscheiden darüber, ob das
neue Haus Segen oder Fluch für die Umgebung bedeuten wird. Insgesamt
wird viermal gebaut.
1840: Neubau des alten Hauses aus Notwendigkeit an zentraler Stelle
mit Fensterposten und Bewahrung des alten Sinns.
1534, vor 300 Jahren: Ersatz des alten Hauses, auf Rat eines weisen
Mannes hin mit Fensterposten und Bewahrung des alten Sinns.
1434, vor 400 Jahren: Bau des Herrschaftshauses aus Angeberei ohne
Fensterposten, brennt ab.
1230, vor 600 Jahre: Schlossbau mit Schattengang hoch oben auf dem
Berg aus Angeberei und Mutwilligkeit.
Von Gotthelf selbst findet man zum Thema "Haus" folgendes Zitat:
Das "Haus" ist des Volkes Grund und Fundament
Elemente aus dem Volks(aber)glauben
Gotthelf bearbeitet folgende Elemente aus dem Volksaberglaube:
1. die Taufmagie: Ein Priester tauft unter Hingabe seines Lebens
ein Kind rettet es so vor der Macht des Bösen. Dabei ist nicht die
Handlung von entscheidender Bedeutung, sondern der Geist, mit dem diese
Handlung vollzogen wird.
2. Magischer Exorzismus: Chrisitine ist eine "Namenschristin".
Durch die Besprengung mit Weihwasser verwandelt sie sich in das Ungeheuer,
das sie immer schon war.
3. Rache: Für die volkstümliche sage ist die Spinne
eine Rächerin, für den Autor ein Dämon, d.h. sie verkörpert
die von den Sünden abgewälzt und auf sie zurückprallende
Angst vor der Sünde: Die Erzählung lehrt, dass man das Böse
nicht loswird, sondern lernen muss, es zu bewahren, d.h. mit ihm umzugehen.
Die Menschen sollen es mit dem Mass an Furcht fürchten, das ihm nach
Gott entgegengebracht werden muss.
4. Schrecken: Die archaische Gewalt des Schreckens ist der Urgrund
der Religion, mit dem man sich immer auseinandersetzen muss. Die meisten
christlichen Figuren der Binnenerzählung erleben Schrecken, Rache
und Tod. Diese Erfahrung zieht bei ihnen aber keine Erkenntnis oder Bekehrung
nach sich. Ob diese Leute sich vom Teufel oder von einem teuflischen Gott
gestraft fählen bleibt gleich.
5. Der rüchende Gott: In der christlichen Theologie ist der rächende
Gott ein archaisches und umstrittenes Element, ebenso wie der "heilige
Kampf" das "Schaugericht". Ë Der christliche Gott verlangt
von seinen Gläubigen, dass sie ihn lieben und fürchten. Lebt
oder fürchtet ein Christ die Natur nicht mehr wegen ihres Schöpfers,
dann wenden die schlimmsten Schrecken gegen ihn.
Weitere Motive: Mahlzeiten, Zahl 3,Teufelsbund
6) Schluss
Novellistischer Charakter
Die vielen Symbole, das Dämonische und das fast unmögliche
Ereignis zeigen, dass es sich um eine moderne Novelle handelt. Viele Symbole
und eine fast unmögliche Ereignis deuten auf eine Novelle, während
das Dämonische auf eine modernere zeigt. Die Novelle wurde ja auch
1842 geschrieben.
Beurteilung
Zuerst fand ich das Buch langweilig, als ich bei der erste Binnengeschichte
anlangte, begann es auf einmal spannend zu werden, und ich konnte kaum
mehr aufhšren zu lesen. Das Buch ist sehr empfehlenswert.
7) Bibliographie
-Die Schwarze Spinne; Reclam
-Kšnigs ErlŠuterungen und Materialen: Jeremias Gotthelf: Die schwarze
Spinne, Der Besenbinder von Rychiswyl;
Folie für Schwarzen Spinne: